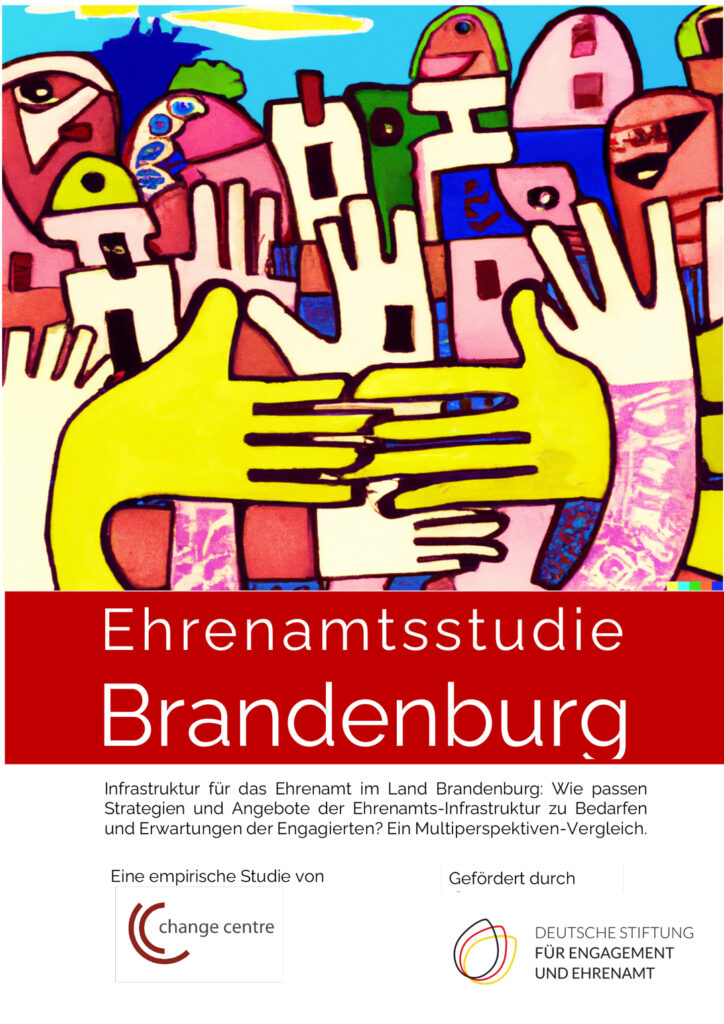Von Pferden Stärke lernen
- Ausgabe 07 / 2023
- geschrieben von Christiane Longrock-Kögel
Sandro, der große Fuchs mit den weißen Fesseln, setzt elegant einen Huf vor den
anderen, gemächlich geht er am Rand der kleinen Straße, die aus dem Dorf hinausführt. Auf seinem Rücken sitzt Merle, 11 Jahre alt, ihr lockiger brauner Zopf schaut unter dem schwarzen Reithelm hervor. Sie hält die Zügel in der Hand, während Sandro sich entspannt in Richtung Kirschbaum-Allee bewegt – dort hängen die Früchte gerade rot und reif vom Baum, vom Pferderücken aus gut erreichbar. Seit sie sechs Jahre alt ist reitet Merle, hat Kontakt zu Pferden. „Das hat mich viel mutiger gemacht“, sagt sie. „Vor vielem hab’ ich keine Angst mehr.“
Ein Besuch in Wienrode, einem Ortsteil der 20.000-Einwohner*innen-Stadt Blankenburg, gelegen am östlichen Rand des Harzes. 800 Menschen leben hier, aber an diesem Sommertag im Juli ist kein Mensch auf der Straße zu sehen. Steffi Halupnik, hennarotes Haar, schmale Jeans und Turnschuhe, öffnet das Tor ihres alten, denkmalgeschützten Vierseithofs an der Langen Straße, die einmal quer durch den Ort führt. Die Psychologin leitet die Reitgruppe von Merle und den beiden
anderen Mädchen, die heute in die Kirschen reiten – aber sie ist viel mehr als nur ihre Reitlehrerin.
Seit 20 Jahren bearbeitet die 45-Jährige die Psyche des Menschen – gemeinsam
mit Pferden. Sie begleitet Kinder und Jugendliche aus der Umgebung genauso wie Gruppen und interessierte Einzelpersonen aus ganz Deutschland. Halupnik ist davon überzeugt, dass der Umgang mit den „sanften und majestätischen Riesen“ ein Weg zur Selbsterkenntnis sein kann. Ein Pferd kann die innere Verfassung seines menschlichen Gegenübers spiegeln. Es ist ein Meister der nonverbalen Kommunikation, liest die Änderungen in Mimik und Gestik und nimmt selbst feine Widersprüche zwischen unseren Worten und unserer Körpersprache wahr. „Das ist eine gute Basis für die Arbeit an uns und unserem Umgang mit anderen“, sagt Halupnik.
Selbstwirksamkeit erfahren
Was sie auf ihrem Hof in Wienrode anbietet, nennt sich „Pferdegestütztes
Coaching“. Man kann es als eine Art Persönlichkeitsentwicklungs-Übung mit verteilten Rollen beschreiben: Die Pferde spiegeln den Klient*innen ihr Auftreten, ihre Verhaltensmuster, ihre Gefühlslage, dann unterstützt Halupnik die Menschen
in Gesprächen dabei, ihre Erkenntnisse in den Alltag zu überführen. Auf dem Reitplatz hinter dem alten Stall geht es darum, Selbstvertrauen, innere Stärke, Mitgefühl und Wertschätzung für sich selbst und andere zu entwickeln. „Der soziale Aspekt ist mir am wichtigsten, angesichts der Aufgaben, vor denen wir stehen: Stärkung der Demokratie, Kampf gegen Krieg und Klimawandel.
Ich denke, Veränderung gelingt am besten, wenn jede*r einzelne die Notwendigkeit erkennt und sich entscheidet, etwas anders zu machen.“ Das Rüstzeug, das es braucht, um die eigene Zukunft und damit auch die der Gemeinschaft verbessern zu können, seien innere Werte wie Empathie und Toleranz – vor allem aber die Erfahrung, selbst wirksam sein zu können. „Und das kann man in der Arbeit mit Pferden ganz konkret erfahren, zum Beispiel wenn es gelingt, ein großes und viel stärkeres Tier zu bewegen. Und zwar ohne Kräftemessen, sondern allein durch Beziehungsarbeit.“

Ein Hof namens „Lisa“
Halupnik hat 15 Jahre in Berlin gelebt und als Reittherapeutin gearbeitet, bevor sie vor vielen Jahren in ihre Heimat zurückzog und gemeinsam mit ihrem Mann mitten in Wienrode einen alten Bauernhof kaufte. Sie nannte ihn „Lisa“, nach ihrem ersten Pferd auf dem Hof, inzwischen pensioniert. Im Nachbarort lebt Halupniks Familie, im 30 Kilometer entfernten Braunlage arbeitet sie in einer psychosomatischen Klinik, auch dort mit Pferden. Schon als Kind, sagt sie, habe sie deren Nähe gesucht, „und es fasziniert mich immer mehr, was sie uns alles beibringen können.“ Die Menschen, die Steffi Halupnik als Coachin buchen, machen Krisen durch, wollen an ihrem Führungsstil arbeiten, den Zusensammenhalt in ihrer Gruppe verbessern oder einen Bildungsurlaub in Wienrode verbringen. Aber es kommen auch Leute, die sich einfach Klarheit über sich selbst verschaffen und zufriedener leben wollen. Seit Jahren sind die Kinder der Wienröder Integrations-Kita und der Wilhelm-Busch-Förderschule regelmäßig auf dem Hof.
Im Innenhof rankt Wein am Balkongeländer, eine große Sitzgruppe aus Holzmöbeln steht einladend in der Mitte, durch die offene Luke sieht man einen runden Heuballen im Speicher. Halupnik blinzelt in die Sonne. Eine der Aufgaben, die sie ihren Klient*innen stellt, lautet: Wie bringe ich ein Pferd dazu, mir freiwillig durch einen Raum zu folgen? Oder, zweites Beispiel: Wie mache ich dem großen Tier nur über Mimik und Körperhaltung klar, dass es einen bestimmten, abgesteckten Bereich – stellvertretend für meine eigenen Grenzen – nicht betreten soll? „Ein Pferd wegschieben geht nicht“, sagt die Reittherapeutin. „Das kann man also nur mental lösen, mit Köpfchen.“


Ein Dorf verstummt
Tritt einem Pferd ein Mensch gegenüber, möchte es wissen, wie es ihn einzuordnen hat. Mit welcher Energie, mit welcher Angst oder Aggression die Person kommt. Jemandem, der nicht weiß, was er will, wird kein Pferd freiwillig durch die Halle folgen. „Man muss sich also von seinen Zweifeln freimachen“, sagt Halupnik. Eine ihrer Klientinnen, schon als Kind dazu erzogen, sich anzupassen und klein zu machen, richtete sich auf dem Reitplatz auf, signalisierte plötzlich Entschlossenheit und Präsenz. „Das Schöne ist, dass eine solche Verhaltensänderung sofort Wirkung zeigt. Und diese Erfahrung ist auf viele andere Lebensbereiche übertragbar.“
Auch auf die Gemeinschaft, den Zusammenhalt in einem Dorf wie Wienrode? Bis vor fünf Jahren gab es hier einen Konsum, der Laden steht seitdem leer, der Rollladen ist geschlos-Zusen. Der Schlachter schräg gegenüber hat Anfang dieses Jahres zugemacht. Mitten im Ort, ebenfalls an der Langen Straße, hat ein Café mit „Trachtenstube“ eröffnet, wirbt mit „hausgemachtem Kuchen und Bio-Kaffeespezialitäten“. Hinter dem Bauzaun, der das dazugehörige Wohnhaus umgibt, leben Mitglieder der Gruppe „Weda Elysia“. Sie sind so genannte völkische Siedler und sollen Kontakt in rechtsextreme Kreise haben. Vor drei Jahren haben sie den leerstehenden Gasthof gekauft. Der Mitteldeutsche Rundfunk hat
2022 eine Dokumentation über die Siedler im Dorfkern gedreht, die die Dorfgemeinschaft spalten. Aber nahezu niemand traute sich, offen mit den Reporter*innen zu sprechen, nachdem Reifen zerstochen und Anfeindungen laut wurden. „Ein Dorf verstummt“, heißt der 30minütige Film.
Wie kann man dem etwas entgegensetzen, ohne sich ständig daran abzuarbeiten? Die eigenen Werte leben, einen respektvollen Umgang miteinander pflegen, das ist Halupniks
Weg. Fünf kleine Gruppen von Reitkindern aus dem Ort sitzen regelmäßig auf ihren Pferden. Auch die Familien versucht sie einzubeziehen, zum Beispiel beim Mensch-Pferd- Theater. Einmal im Jahr gibt es eine Aufführung, zuletzt war „Die Wienröder Dorfmusikanten“ zu sehen. Alle sind zu Kaffee, Kuchen und Live-Musik willkommen – eine Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Die Pferde bringen hier Menschen zusammen, die sonst selten zusammen Kaffee trinken. Halupnik saß im Ortschaftsrat, hat in der Gemeinde auch eine Baumpflanzaktion und einen Kurzfilmabend initiiert – Angebote für ein Dorf, in dem es keinen Sportverein oder andere Freizeitaktivitäten gibt. „Wir fangen hier im Kleinen an, aber die Wirkung schwappt hoffentlich auch nach draußen.“ Die Jugendlichen, die zu Halupnik kommen, sind die, die auch bei anderen Gelegenheiten anpacken, Angebote zum Mittun schaffen, sich für ein dörfliches Miteinander engagieren.
Sich den Ängsten stellen
Hoch auf dem Rücken von Perla, einem kräftigen grauen Pferd, denkt die zehnjährige Carla über die Frage nach, was ihr der Umgang mit den Pferden gebe. „Geduld“, sagt sie
dann ernsthaft. „Und ich lerne von ihnen etwas über Freundschaft.“ Die kleine Gruppe macht sich auf den Rückweg zum Hof; aus dem Kirschenessen ist nicht allzuviel geworden, die drei Mädchen auf den Pferden waren mehr mit der Mensch-Tier-Interaktion als mit dem Pflücken beschäftigt. Denn auch Pferde lieben Kirschen, dürfen sie aber nicht essen. Kurz vor dem Dorfschild macht eines der Tiere so lange Spirenzchen, bis seine Reiterin abeit steigt, sichtlich aufgewühlt. Steffi Halupnik schwingt sich selbst auf das Pferd, stellt die Beziehungen wieder klar. Vorhin, in ihrem schönen
Innenhof, hat sie erzählt, dass die Jugendlichen im Umgang mit den Pferden lernten, sich ihren Ängsten zu stellen. Nach einer kleinen Pause setzt sich die junge Reiterin ihren
Helm wieder auf, setzt den Fuß in den Steigbügel. Ein paar Mal muckt Perla, das Pferd unter ihr, noch auf. Dann stimmt die Kommunikation, und Perla geht wie eine Eins.