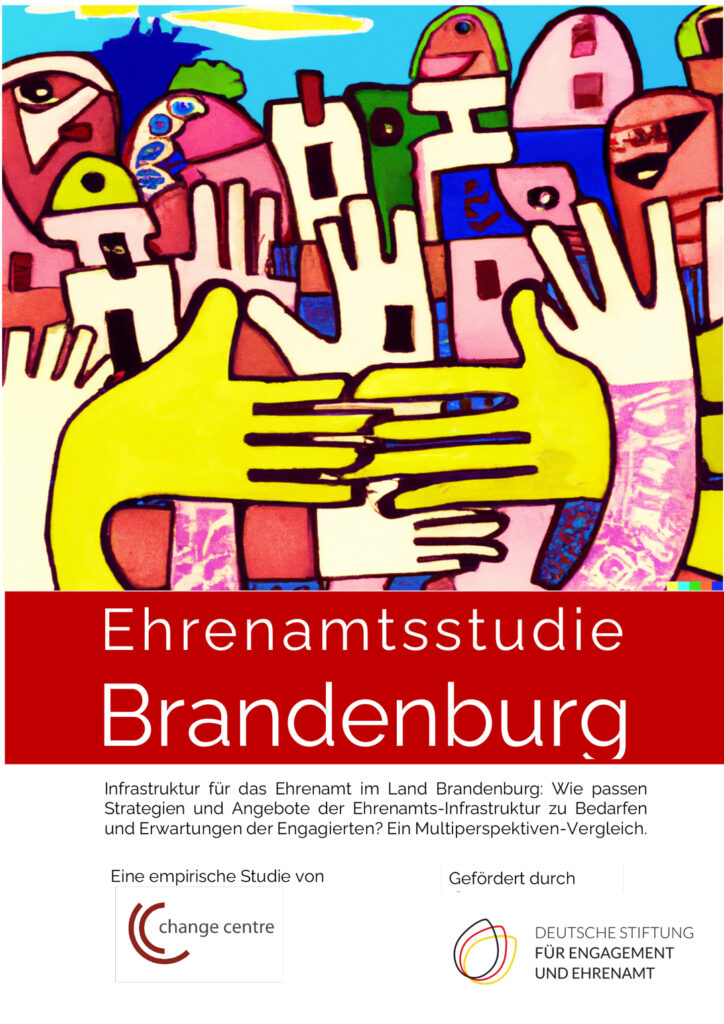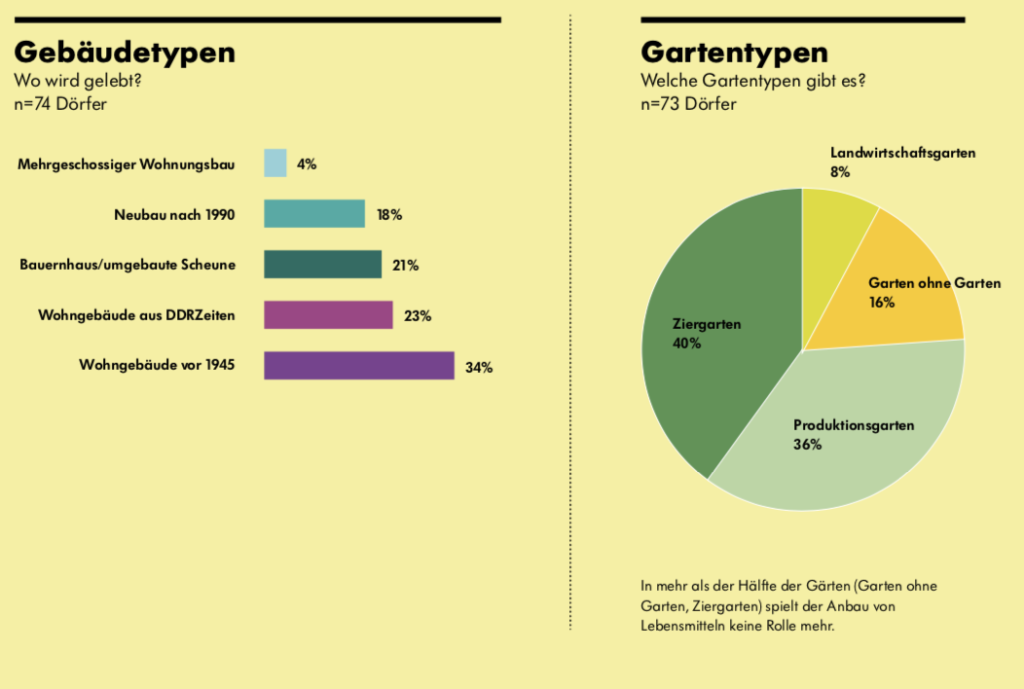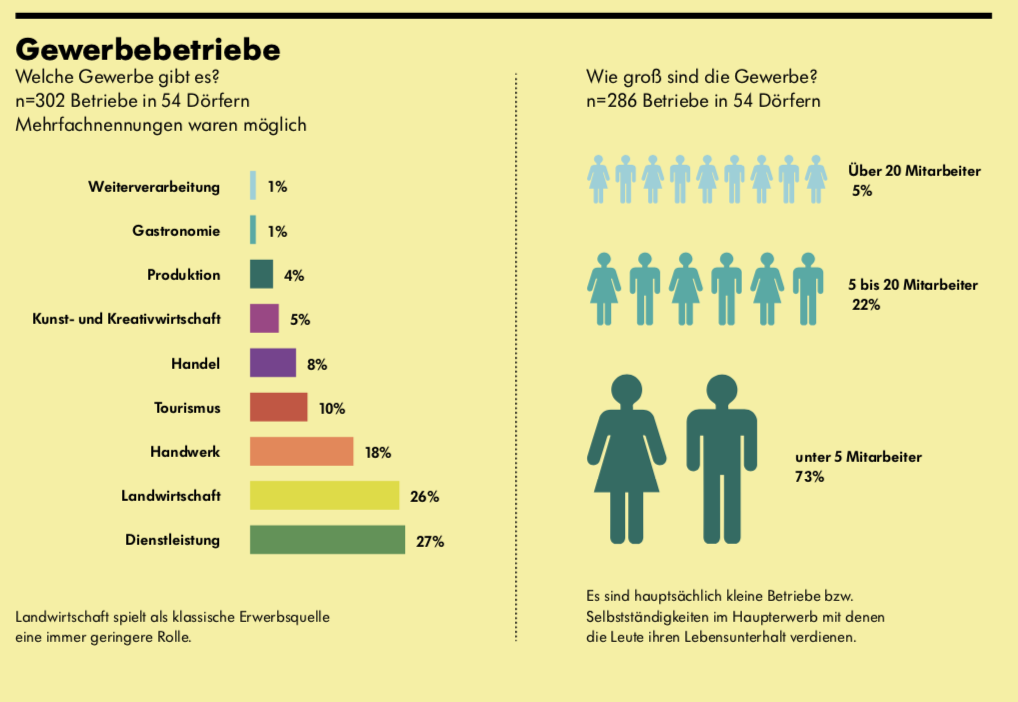- Ausgabe 07 / 2023
- geschrieben von Thomas Friemel

Herr Klewes, Sie und Ihr Team haben die erste, sehr umfassende Studie zur Engagementförderung im Land Brandenburg vorgelegt. Was hat Sie am meisten überrascht?
Joachim Klewes: Es gibt zwar schon viele Angebote für Engagementunterstützung in den Kommunen Brandenburgs, aber unsere Daten zeigen: Die Nachfrage danach ist etwa viermal so hoch. In einem Fall, bei der Kinderbetreuung während des Ehrenamts, sogar zehnmal so hoch. Die ist bei uns in Brandenburg so gut wie nicht vorhanden. Das erschwert besonders das Engagement von Eltern und Alleinerziehenden.
Zu welchen Kernergebnissen sind Sie sonst noch gekommen?
Gute Kommunalpolitik und gute Verwaltung sind entscheidend. Wenn eine Kommune viel fürs Ehrenamt tut, entwickelt sich auch das Engagement deutlich besser. Das zeigen die Daten ganz klar. Und wir haben festgestellt, dass die Befragten aus den Vereinen und Initiativen den Status Quo der Unterstützung deutlich anders als die Befragten aus den kommunalen Verwaltungen einschätzen. Da gibt es offenbar ein Kommunikationsproblem.

Dr. Joachim Klewes leitet das Brandenburger Institut Change Centre. Er lehrte als Honorarprofessor an der Freien Universität Berlin und der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und wirkte als Geschäftsführer und Aufsichtsrat mehrerer Forschungs- und Beratungsfirmen. Klewes hat jahrzehntelange Erfahrung aus Studien und Beratungsmandaten zu gesellschaftlichen Veränderungsthemen.
Wie werten Sie die Ergebnisse im Kontext der übrigen ostdeutschen Bundesländer?
Andere Bundesländer haben wir in unserer Studie nicht erhoben. Allerdings: Der repräsentative Freiwilligen-Survey zeigt seit Jahren, dass Brandenburg im Bundesländer-Vergleich immer auf den hinteren Plätzen liegt. Das gilt zum Beispiel für gemeinschaftliche Aktivitäten, Vereinsmitgliedschaften, Engagementbereitschaft oder auch die Spendentätigkeit. Aber auch die anderen ostdeutschen Bundesländer belegen die hinteren Plätze.
Welche Erklärung haben Sie, dass die ostdeutschen Bundesländer auch nach über dreißig Jahren Einheit bei diesem Thema hinterherhinken?
Das haben wir nicht erhoben. Meine These ist, dass es hauptsächlich zwei Ursachen-Komplexe gibt. Zum einen wirkt die DDR-Zeit nach. Da waren viele Menschen in ehrenamtsähnlichen Funktionen in Betrieben und Massenorganisationen aktiv. Wir Menschen im Osten sind ja nicht weniger hilfsbereit oder gemeinschaftsorientiert als die im Westen. Aber es sind eben in erheblichem Maß Gemeinschaft stiftende Strukturen erodiert. Einen Verein oder eine neue Initiative hochzufahren, dauert oft Jahrzehnte. Der zweite Aspekt ist das generelle Ausdünnen von Infrastrukturen im Osten, besonders auf dem Land: Das betrifft nicht nur die in den Flächenländern wichtige Verkehrsinfrastruktur. Sondern auch zum Beispiel Wohlfahrtsorganisationen, in deren Umfeld sich Engagement entwickelt, reicht aber bis zu Gemeindehäusern oder auch Gaststätten, in denen sich Vereine treffen. Wenn es all dies nur noch seltengibt, fällt es Menschen deutlich schwieriger sich zu engagieren.
Auf der Grundlage Ihrer Ergebnisse haben Sie umfassende Impulse als Empfehlungen unter anderem für die Landespolitik vorgestellt. Welche sind das?
Im Kern empfehlen wir auf Landesebene baldmöglichst die Entwicklung eines verbindlichen Masterplans für die Engagementförderung der Brandenburger Kommunen. Da sollten klare Ziele und Termine drinstehen. Weiter die Überprüfung relevanter Landesgesetze und sonstiger Regelungen der Landespolitik auf Engagementfreundlichkeit durch eine interfraktionelle Arbeitsgruppe. Auf dieser Grundlage könnten vielleicht sogar Änderungen in der Kommunalverfassung erarbeitet werden.
In Brandenburg kommen wir auf einen Engagementwert von zwei Milliarden Euro. Das ist Geld, das Staat und Wohlfahrtseinrichtungen sparen.
Klingt sehr abstrakt …
Mit konkreten Auswirkungen. Man könnte die Kommunen etwa dazu anhalten, einen Engagementbeirat aufzustellen, eine Engagementstrategie gemeinsam mit allen Akteuren zu erarbeiten und konkrete Ansprechpersonen für Engagement zu benennen. Damit würde man nicht nur Aufmerksamkeit und Energie aufs Thema lenken. Sondern die Bürgerschaft hätte so auch ein Anrecht darauf, Engagementförderung von der Kommune einzufordern. Sie wäre kein Bittsteller mehr.
Ihre Empfehlungen bezüglich Strategie und Ansprechpersonen erinnert sehr an deutschlandweite Programme wie etwa „Engagierte Stadt“ und „Engagiertes Land“, die von Stiftungen und Bundesfamilienministerium unterstützt werden. Muss man das Rad immer wieder neu erfinden?
Natürlich nicht. Aber wir müssen genau hinsehen, wie solche übergreifenden Programme wirken, wenn es vor Ort konkret wird. Wir vergleichen mit unseren Daten beispielsweise gerade die sechs geförderten Brandenburger Kommunen aus dem Programm Engagierte Stadt mit sechs ähnlichen, aber nicht geförderten Städten und auch mit allen Befragten in Brandenburg. Vorläufiges Ergebnis: Es gibt keine belastbaren Unterschiede. Da darf man schon einmal fragen, was diese Förderung gebracht hat.
Ein anderer Hebel für die Landespolitik zielt auf die Schulen ab. Welche Empfehlungen sind das?
Das Land verantwortet Schulpolitik und Lehrpläne. Da gibt es viele Möglichkeiten. Etwa Projekttage, in denen Schülerinnen und Schüler zu selbstgewählten Themen Engagement trainieren. Vereine und Wohlfahrtsorganisationen könnten sich in den Schulen vorstellen und fürs Ehrenamt werben. Eine andere Idee: Ausbau der Förderung von Eltern und Schülervereinen und deren Engagement.
Ein zweiter Maßnahmenkomplex bezieht sich auf den Ausbau der mobilen Beratung für Kommunen. Was soll das sein?
Mobile Beratung der Kommunen gibt es bei uns beispielsweise über das Brandenburgische Institut für Gemeinwesenberatung zu mehreren Themen. Auch das Forum ländlicher Raum bietet mit verschiedenen Seminar- und Dialogformaten wertvolle Plattformen. Wir schlagen vor, institutionsübergreifend Beratungsangebote zum Thema Engagement auszubauen und gebündelt an die Kommunen heranzutragen.
Was schwebt Ihnen konkret vor?
Die Inhalte können breit gefächert sein. Man könnte den Kommunen zum Beispiel Hilfe anbieten, welche Angebote man für Engagierte ganz leicht vor Ort realisieren kann und welche rechtlichen, finanziellen und organisatorischen Aspekte dabei zu beachten sind. Oder ganz einfach: Wie organisiere ich eigentlich ein Fest der Vereine und was kann ich dabei von anderen Kommunen lernen? Etwas anspruchsvoller ist vielleicht die Beratung, wie eine kommunale Ehrenamtsstrategie gemeinsam mit allen Akteuren entwickelt werden kann.
Gibt es nicht schon eine Reihe dieser Unterstützungsangebote bereits von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, der DSEE?
Die Online-Angebote der DSEE sind wirklich sehr gut. Sie wenden sich aber eher an Vereine und einzelne Engagierte, nicht an Kommunen. Wenn man dort in die Infrastruktur hineinwirken möchte, muss man sich an die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen oder Verwaltungschefs direkt wenden. Das könnte Aufgabe der mobilen Beratung sein.
Geradezu revolutionär mutet ihr Vorschlag für eine Umkehr des Vergütungsprinzips für Engagementqualifikation an. Können Sie das erklären?
Engagierte leisten mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit für die Gemeinschaft einen Gegenwert von vielen Milliarden Euro im Jahr, allein in Nordrhein-Westfalen sind das laut einer FORSA-Studie 19 Milliarden Euro nur auf Basis des Mindestlohns. Wenn wir das auf Brandenburg umrechnen, kämen wir auf einen Engagementwert von über zwei Milliarden Euro im Jahr. Das ist Geld, das Staat und Wohlfahrtseinrichtungen sparen. Warum also sollten Engagierte dann noch selbst für ihre Fortbildung zahlen? Wenn Brandenburg nur ein Prozent der genannten Summe beispielsweise in die Fortbildung für Engagierte stecken würde, wären das 20 Millionen Euro im Jahr. Eine Investition, die vielfach Früchte für die Gemeinschaft tragen würde.
Schauen wir auf Ihre Empfehlungen auf kommunaler Ebene. Außer jener zur Entwicklung einer lokalen Engagementstrategie schlagen Sie den Aufbau einer Datenbank vor. Klingt zunächst banal.
Gute Ideen sind oft einfach. Wenn man zusammenstellt, welche Vereine und Initiativen es in einer Kommune gibt, kommt man im Idealfall mit ihnen ins Gespräch. Man lernt die Verantwortlichen kennen und hört, was genau gemacht wird. Schon ist man mitten im Netzwerkaufbau und wird Teil der Engagierten-Landschaft. Der Aufbau einer Datenbank hat also nicht nur einen ganz praktischen Nutzen, sondern auch einen strategischen. Genauso wie etwa der Aufbau eines kommunalen Verleihservices. Man erhebt als Kommune die Bedarfe und stellt dann entsprechendes Material zur Verfügung, etwa eine Garnitur fürs Vereinsfest, Transportfahrzeuge, einen Beamer, Werkzeuge oder ein Lager, abgewickelt über die kommunalen Bauhöfe oder Bibliotheken. Auch daskönnte als Ansatz genutzt werden, um mit Engagierten in einen stärkeren Austausch zu kommen.
Und in den Aufbau eines Engagement-Rats münden, den Sie den Kommunen empfehlen?
Vielleicht. In jedem Fall sorgt die Institutionalisierung solcher Gremien – wie auch ein Engagement-Ausschuss im Landtag – dafür, dass man sich mit dem Thema intensiver beschäftigen muss. Man bündelt Expertise und fördert die Vernetzung. Außerdem schaffen solche Gremien Öffentlichkeit.
Ein letzter interessanter Gedanke in Ihrer Studie ist die Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit. Was hat es damit auf sich?
Wir haben diesen Vorschlag aus den qualitativen Einzelbeiträgen zur Befragung aufgegriffen, weil wir ihn spannend fanden. Der Kerngedanke: Ehrenamtliche Angebote könntenden Wiedereinstieg ins Berufsleben vorbereiten, mindestens aber das Selbstwertgefühl steigern.
Wie ließe sich so etwas implementieren?
Das geht nur top-down, da muss man mit einer Person aus der Leitungsebene der Agentur für Arbeit ins Gespräch kommen. Man könnte gemeinsam Modelle entwickeln, sie in kleinen Regionen ausprobieren, wissenschaftlich evaluieren, anpassen und dann ausrollen.
Klingt nach einem langen Weg.
Ja, aber es muss ja nicht immer alles gleich perfekt sein. Das gilt ja für alle unsere Vorschläge. Man kann schnell und in unterschiedlichen Variationen Prototypen mit Methoden wie Design Thinking entwickeln und dann an verschiedenen Orten testen. Was am besten funktioniert, wird weiterentwickelt. Es geht ums Anfangen.